 |
 |
 |
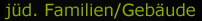 |
 |
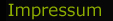 |
Im Sommer 1989 begann ich ein einjähriges Studienprojekt mit einer polnischen Partneruniversität. Zum Abschluss schenkte die Universität Stettin uns eine Rundreise durch Polen. Dabei kamen wir auch nach Auschwitz. Gleich am nächsten Tag hatte ich die Gelegenheit, einen Abstecher in die Heimatstadt meiner Mutter, Guttentag, zu machen, aus der sie als Dreijährige geflüchtet war. Es war ein merkwürdiges Gefühl. Ich kannte so viele Erzählungen, aber ich hatte mir Guttentag nie als konkreten Ort vorgestellt, räumlich war er durch den eisernen Vorhang ja unerreichbar und außerdem aus einer längst vergangenen Zeit. Nun stand ich dort und es war ein ganz normales, polnisches Kleinstädtchen. Mein Großvater, Wilhelm Schatka (geb. 1899), war dort Schuhhändler gewesen und war den Erzählungen nach ein reicher Mann. Er habe für jedes seiner 6 Kinder bereits Häuser gekauft gehabt und sei der erste im Ort mit einem Auto gewesen. Eine ehemalige Verkäuferin meines Großvaters führte mich durch den Ort und an einer Stelle sagte sie beiläufig, dass hier die jüdische Schule gestanden habe, die mein Großvater gekauft habe. Ich habe das in diesem Moment gar nicht realisiert und keine weiteren Fragen gestellt.
Ich kam nach Hause und begann Fragen nach der jüdischen Schule zu stellen. Ich erhielt nur unbefriedigende Antworten. Mein Großvater habe den Juden doch nur helfen wollen und alles sei doch legal gewesen. Ich hatte gleich das Gefühl, dass ich zurück nach Polen fahren müsste, aber ich war eine blutjunge Studentin und hatte kein Geld für die Reise. Außerdem wusste ich nicht so recht, wie ich dort an Informationen kommen sollte.
An dem folgenden Wochenende eskalierte die Situation. Helmut Kohl akzeptierte die polnische Westgrenze und mein Vater, der als 5jähriger aus Pommern geflüchtet war, began am Mittagstisch nicht nur zu schimpfen, sondern auch Nazi-Parolen zu pöbeln. Kohl könne doch seine Heimat nicht verschenken und schließlich sei Deutschland ein Volk ohne Land. Ein Wort gab das andere und am Ende brüllte mein Vater, ich solle doch nicht nach Auschwitz fahren, wenn ich das nicht ertragen könne. Ich reiste ab und dachte, ich würde nie wieder kommen. Mein Vater hatte aber zumindest den Ernst der Situation verstanden und rief mich zum ersten und einzigen Mal in seinem Leben an. Wir einigten uns stillschweigend darauf, nie wieder über kritische Fragen zu sprechen. Wir haben uns beide daran gehalten und bis zu seinem Tod 2002 allenfalls noch über das Wetter und das Essen geredet.
2013 starb meine Mutter und es kam zum Bruch mit meiner Familie mütterlicherseits inklusive meiner einzigen Schwester und zu einem erbitterten Erbstreit. Ich verstand nicht, was da passierte, warum es nicht möglich war, miteinander zu reden und den Konflikt konstruktiv zu lösen, obwohl zahlreiche Lösungsmöglichkeiten offen auf dem Tisch lagen. In der Hoffnung, die Mechanismen des Familienkonfliktes zu verstehen, ging ich erneut auf die Suche nach der Familiengeschichte. Ich stieß auf Akten aus dem Lastenausgleichsverfahrens meines Großvaters. Sie wurden der Ausgangspunkt einer längeren Recherche.
Nach Abschluss dieser Recherche bin ich davon überzeugt, dass der heutige Familienkonflikt im Kontext der Familiengeschichte besser zu verstehen ist. Darüber hinaus kam bei den Recherchen die filmreife Geschichte einer jüdischen Familie zum Vorschein. Sie ist filmreif,
Mit dieser website möchte ich der Familie Eisner wenigstens ein kleines Denkmal setzen, damit nie wieder vergessen werden kann, was ihnen geschah.
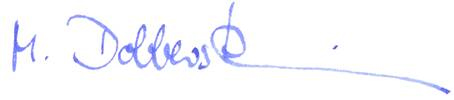
PS: Im Verlauf der Recherche habe ich immer mehr Informationen auch über andere jüdische Familien erfahren. Diese Informationen habe ich im Kapitel Andere Familien dokumentiert.